Selberlesen oder Verschenken - dazu einige Tipps von uns.
Wenn Sie auf den Geschmack kommen, bestellen Sie gleich hier.
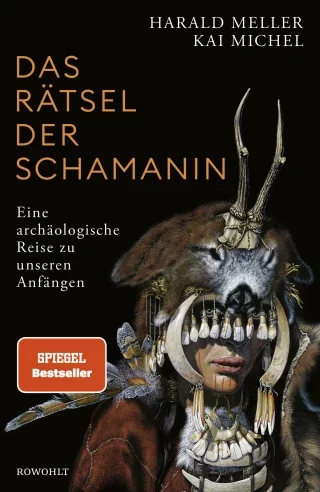
Das Rätsel der Schamanin Harald Meller / Kai Michel
Harald Meller und Kai Michel weisen in ihrem spannenden und humorvoll geschriebenen Buch nach, wie das patriarchale, ideologische und koloniale Denken in der Archäologie und der Geschichtsforschung eine unheilige Allianz eingegangen sind, um den jeweiligen Zeitgeist zu bestärken. Das hat mit unvoreingenommener, neutraler Wissenschaft nichts zu tun. Geht man aber objektiv an die Historie, dann hat die Archäologie das Potential, unsere Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Die Schamanin von Bad Dürrenberg erwacht wieder zum Leben und hat uns auch heute noch etwas Wichtiges zu sagen – nämlich, woher wir kommen und wie die Vergangenheit in uns bis heute nachwirkt. Sie holt das zutiefst Menschliche wieder ans Tageslicht, das uns immer wieder die Richtung zeigt im Umgang mit der Welt. Deshalb ist die Vergangenheit gerade heute so aktuell wie nie zuvor, denn sie weist Richtungen auf, die zu Lösungen der aktuellen Katastrophen führen können. Heller und Michel ist damit ein wichtiges Buch gelungen, das gut mit heutigen Erkenntnissen über den Schutz der Umwelt, mit dem spirituellen Grundbedürfnis der Menschen und mit einem guten sozialen Miteinander verbunden werden kann.
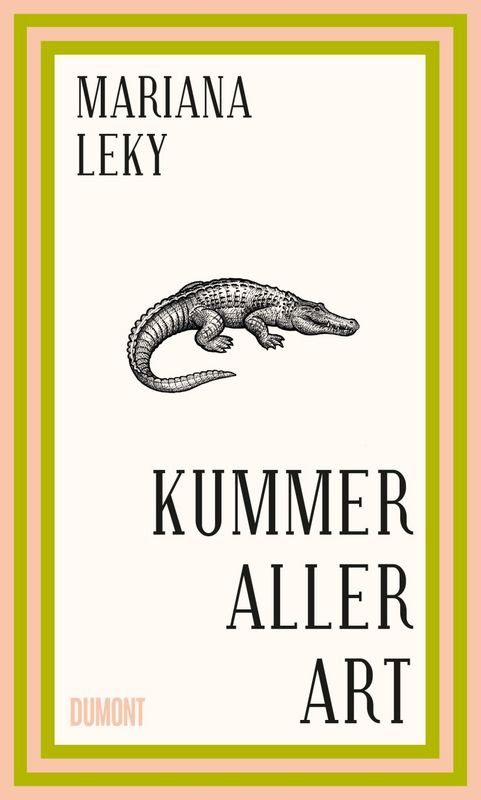
Kummer aller Art Mariana Leky
Das neue Buch von Mariana Leky sind Kolumnen, die bereits in der Zeitschrift "Psychologie heute" erschienen sind. Doch hier wurden sie zusammengefasst und nehmen dadurch beinahe die Gestalt eines Romans an. Wie schon in ihren früheren Büchern beobachtet die Autorin mit Wärme und Humor ihre Mitmenschen. Diesmal die Bewohner eines Mehrfamilienhauses. So schreibt sie über Frau Wiese, die nicht mehr schlafen kann; Herrn Pohl der nachhaltig verzagt ist; Lisas ersten Liebeskummer; Frau Schwerter muss ganz dringend entspannen, ein trauriger Patient hat seine Herde verloren, und Psychoanalytiker Ulrich legt sich mit der Vergänglichkeit an. Kummer aller Art plagt die Menschen, die sich, mal besser, mal schlechter, durch den Alltag manövrieren. Aber durch den Kummer sind sie vereint. Und das ist schon mal eine Hilfe!
Klug, humorvoll und mit großem Sinn für Feinheiten und Absurditäten porträtiert Mariana Leky Lebenslagen von Menschen, denen es nicht an Zugänglichkeit mangelt, wohl aber am Mut zur Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft ausweichen kann.

Ursprung Eva Tind (übersetzt von Ursel Allenstein)
Als Sui mit achtzehn von zu Hause auszieht, gerät ihr Vater Kai in eine Krise. Er hat Sui allein großgezogen, weil ihre Mutter Miriam sich ganz ihrer Karriere als Künstlerin widmete. Während Kai seinem Architekturbüro den Rücken kehrt, um in Indien Kraft und neuen Sinn zu finden, verlässt auch Sui Kopenhagen und fährt zu ihrer Mutter, die inzwischen in einem einsamen Waldgebiet lebt. Doch die Begegnung mit Miriam bringt Sui nicht die erhofften Antworten. Auf der Suche nach ihren väterlichen Wurzeln reist sie weiter auf die koreanische Insel Marado, ins Matriarchat der Perlentaucherinnen. Es ist eine Familiengeschichte der anderen Art – poetisch, modern und bisweilen ein bisschen spirituell. Die Kapitel werden jeweils aus der Perspektive eines der drei Protagonisten erzählt. So verweben sich die einzelnen Geschichten Stück für Stück zu einem lebendigen Kosmos, in dem alle um alle kreisen und doch für sich in ihrer Individualität unangetastet bleiben. Tind beschreibt eine Suche nach der eigenen Identität, nach einem anderen Familienmodell und nach einem Miteinander ohne sich selbst zu verlieren.

Yoga Emmanuel Carrère (übersetzt von Claudia Hamm)
"Yoga" beginnt zunächst ganz heiter: Der Ich-Erzähler plant ein feinsinniges Büchlein über Yoga und das Verhältnis zur Welt, wenn man Abstand zum eigenen Ego gewinnt. Doch dann kippt sein Leben: beim Anschlag auf »Charlie Hebdo« stirbt ein Freund, Carrère wird von einer unkontrollierbaren Leidenschaft erschüttert, eine bipolare Störung wird diagnostiziert, und er verbringt vier quälende Monate in der Psychiatrie, wo er versucht, seinen Geist mit Gedichten an die Leine zu legen. Entlassen und verlassen lernt er auf Leros mit einer Gruppe minderjähriger Geflüchteter ganz anders Haltlose kennen – und doch gibt es auch immer wieder Licht. Denn diese Selbstanalyse zwischen Autobiografie, Essay und Roman erzählt vom mal beherrschten, mal entfesselten Schwanken zwischen den Gegensätzen. Nein, ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga ist es nicht geworden. Trotzdem ist es vielleicht ein Buch über Yoga, über die Haltungsfrage, wie man mit seinem Blick auf die Welt umgeht. Mit seinem Blick auf sich selbst. Und auf andere. Und wie man damit umgeht, wenn nichts mehr geht. Gar nichts mehr. Und vielleicht ist auch ein Buch über die Liebe. Trotz aller Auslassungen und Leerstellen. Gerade deshalb. Gerade deshalb auch ein wirklich gutes.

Die Wut, die bleibt Mareike Fallwickl
Ein Roman über die Last, die auf den Frauen abgeladen wird, und das Aufbegehren: Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Sie entzieht sich dem, was das Leben einer Mutter zumutet. Plötzlich fehlt der Familie alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Helenes beste Freundin Sarah, die Helene ihrer Familie wegen zugleich beneidet und bemitleidet hat, wird in den Strudel der Trauer und des Chaos gezogen. Lola, die Tochter von Helene, sucht nach einer Möglichkeit, mit ihren Emotionen fertigzuwerden, und konzentriert sich auf das Gefühl, das am stärksten ist: Wut. Die drei Frauen sind weder Klischee noch Schablone. Sie sind differenziert gezeichnete Figuren, die die Rolle und Stellung der Frau in der Gesellschaft scharf abbilden, die mit einer untragbaren Anspruchshaltung an ihr Äußeres und Inneres konfrontiert sind. Helene verweigert sich der ihr zugedachten Rolle in der Absolutheit des Suizids. Sarah tastet sich mühsam und langsam vor in Richtung Selbstermächtigung. Lola radikalisiert sich und schlägt in einer Gruppe von Gleichgesinnten zurück. Aus Opfern werden Rächerinnen. Und ja, das bereitet zwischendurch ein dunkles Vergnügen.
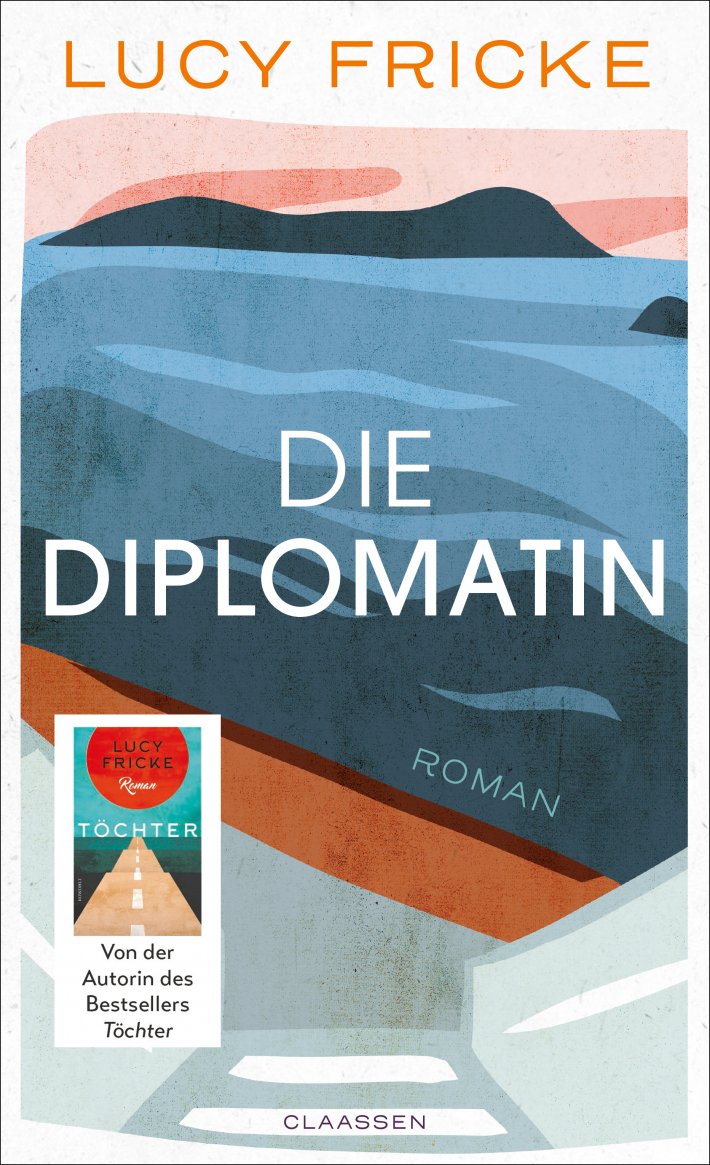
Die Diplomatin Lucy Fricke
Fred hat Erfahrung als Konsulin. Sie ist eine Frau, die eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Sie ist überall und nirgends zu Hause. Doch nach unvorgesehenen Ereignissen in Montevideo scheitert sie erstmals in ihrer Karriere und wird ins politisch aufgeheizte Istanbul versetzt. Dort versucht sie, auf nicht immer legale Art und Weise, auf politische Ereignisse einzuwirken. Zwischen Justizpalast und Sommerresidenz, Geheimdienst und deutsch-türkischer Zusammenarbeit, zwischen Affäre und Einsamkeit stößt sie an die Grenzen von Freundschaft, Rechtsstaatlichkeit und europäischer Idee. Sie beginnt am Sinn ihres Berufes und ihrem Glauben an Diplomatie zu zweifeln. Realitätsnah und mit trockenem Humor wird der Diplomatenalltag beschrieben, der neben den außenpolitischen Dimensionen auch sehr komische Seiten hat.

Zukunftsmusik Katerina Poladjan
In einer Kommunalka, westlich von Moskau, leben Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin auf engstem Raum. Es ist der 11.März 1985. Der Beginn einer neuen Zeit, von der zu diesem Zeitpunkt noch niemand etwas ahnt. Gorbatschow wird der nächste Generalsekretär des Zentralkomitees und wird versuchen mit Glasnost und Perestroika der Sowjetunion eine neue Richtung zu geben. Doch noch herrscht eine Stimmung der gegenseitigen Zurückhaltung und des Misstrauens, die bei den Bewohnern der Kommunalka auf unterschiedlichste Weise zum Vorschein kommt. Jeder geht seinem Alltag nach. Der Ingenieur von nebenan versucht, sein Leben in Kästchen zu sortieren, Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe, Janka will am Abend in der Küche singen. Katerina Poladjan beschreibt mit Humor und teils surrealen Bildern die Stimmung dieser Zeit und die Sehnsucht der Menschen nach einer Verbesserung ihrer Lebensumstände. Aus heutiger Sicht gab es nach 1985 viele positive Veränderungen und um so bedrückter blickt man auf die aktuelle Situation in Rußland.

Der Himmel über Bay City Catherine Mavrikakis, übersetzt von Sonja Finck und Patricia Klobusiczky
Bay City, 1960: Am Ende der Veronica Lane im amerikanischen Niemandsland wird ein Wellblechhaus abgeliefert, eine Familie zieht ein. Das kriegsverheerte Europa haben sie hinter sich gelassen, denn damals scheint die Zukunft in Amerika zu liegen, diesem Land, in dem alles neuer, bunter, fröhlicher ist. Die Geschichte lässt sich aber nicht verdrängen. Amy, in den USA geboren, wird in ihren Träumen von den in Auschwitz ermordeten Mitgliedern ihrer Familie heimgesucht und macht eines Tages im Keller des kleinen Wellblechhauses eine verstörende Entdeckung. Eine Entdeckung, die sie niemals vollständig verlassen wird – gleichgültig wo auf der Welt sie sich befindet, ob in entlegenen Landschaften oder der Weite des Himmels.
Dieses Buch ist vom ersten bis zum letzten Wort ein Albtraum, ein wahrer Höllenritt und eines der besten Bücher der letzten Zeit. Inhalt und Sprache sind dicht, reduziert und roh und gleichzeitig von einer düsteren Schönheit. Die Bilder, die Mavrikakis zeichnet, sind scharf ausgeleuchtet, mit harten Farben, die keine Schatten werfen. Kein Wort zu viel, kein Bild zu viel. Monolithisch steht Sequenz neben Sequenz und entwickelt einen ungeheuerlichen Sog. (KH)

Ein erhabenes Königreich Yaa Gyasi
Gifty, Tochter eines Einwandererpaars aus Ghana, hat es geschafft: sie ist eine erfolgreiche Neurowissenschaftlerin geworden und erforscht in einem Labor der kalifornischen Stanford University das Suchtverhalten von Mäusen. Eines Tages findet sie ihre Mutter, von der sie länger nichts gehört hat, in ihrer Wohnung vor: teilnahmslos liegt sie im Bett und reagiert auf keinerlei Ansprache. Das bleibt für Wochen so und weckt in Gifty schmerzhafte Erinnerungen an ihre Kindheit; als sie 11 Jahre alt war, ist ihr neun Jahre älterer Bruder an einer Überdosis Heroin gestorben, worauf die Mutter in eine schwere Depression verfiel. Der Vater, der besonders unter dem üblichen Alltagsrassismus litt, war damals schon zurück nach Ghana gegangen. Gifty war mehr oder weniger auf sich gestellt, fand einen gewissen Halt in einer evangelikalen Gemeinde und später dann in der Wissenschaft. Erkenntnis statt Emotionen – dafür hat sie sich entschieden, sie lebt für ihre Forschung, private Beziehungen vermeidet sie weitgehend.
Dieser Schutzpanzer wird nun mit dem Auftauchen der immer noch tief gläubigen Mutter brüchig. Depression und Sucht in der eigenen Familie – was nützt hier das hirnphysiologische Wissen?
Gifty versucht einen neuen persönlicheren Zugang, indem sie sich den Erinnerungen stellt.

Daheim Judith Herrmann
Eine Frau um die fünfzig versucht einen Neuanfang: nachdem ihre Tochter erwachsen ist, verlässt sie ihren Ehemann Otis und zieht in einen kleinen Ort an der Ostsee, wo ihr Bruder eine Hafenkneipe betreibt. Sie mietet eine einfache Bauernkate und arbeitet bei ihrem Bruder als Kellnerin. Vorsichtig knüpft sie erste Bekanntschaften: mit Mimi, einer Künstlerin, und mit Arild, der auf seinem Bauernhof tausend Schweine hält. Mit diesem unzugänglichen und wortkargen Mann beginnt sie eine Affäre, wohl wissend, dass daraus keine tiefere Beziehung werden kann. "Wir sind Trabanten, denke ich, wir kreisen um unsere Sonnen, jeder um seine eigene". In fragmentarischen Rückblicken auf ihr Leben wird deutlich, dass dies wohl für alle ihre Beziehungen galt. Was weiß sie von ihrer Tochter Ann, die bindungslos durch die Welt zieht und nur gelegentlich per SMS ihren Aufenthaltsort mitteilt? Und was bedeutet ihr Otis, mit dem sie immer noch Briefkontakt hat? Kann es für sie überhaupt ein neues Leben oder gar erstmals ein „Daheim“ geben? Judith Herrmann hat einen makellosen Roman geschrieben, in dem jeder Satz sitzt. Bedeutsam ist auch, was nicht erzählt wird; hier ist der Leser gefragt. Deshalb wirkt das Buch lange nach.
„Daheim“ wurde für den Leipziger Buchpreis 2021 nominiert.

Welten auseinander Julia Franck
Nach zwei Romanen, die von ihrer Familiengeschichte inspiriert waren, ist „Welten auseinander“ der Bericht einer verstörenden Kindheit und Jugend. Mit acht Jahren übersiedelte Julia Franck mit ihrer alleinerziehenden Mutter und den Schwestern in den Westen; zuerst in das Notaufnahmelager Marienfelde, später in ein heruntergekommenes Bauernhaus in Schleswig-Holstein, wo sie von Sozialhilfe leben. Die Verhältnisse sind chaotisch, die Mutter völlig überfordert, die Kinder verwahrlosen regelrecht. Schon früh sucht Julia Zuflucht in Büchern und schreibt wie besessen Tagebuch. Mit dreizehn hält sie es nicht mehr aus und zieht nach Berlin, zunächst zu einem befreundeten Paar, dann in eine WG. Sie lernt ihren Vater kennen und verliert ihn bald wieder, schlägt sich mit Putzen durch und schafft trotz allem das Abitur. Sie begegnet Stephan, ein neues, glückliches Kapitel in ihrem Leben scheint zu beginnen, doch dann kommt alles anders...
Es ist ein autobiographischer Text, der ohne Pathos, Bitterkeit und Selbstmitleid auskommt und über das persönlich Erlebte hinausweist. Bewegend!
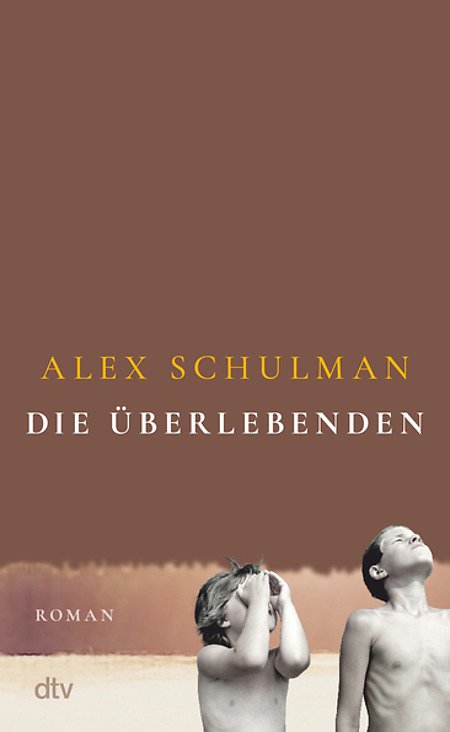
Die Überlebenden Alex Schulman
Nach zwei Jahrzehnten kehren die Brüder Benjamin, Pierre und Nils zu einem Ort ihrer Kindheit – ein Holzhaus am See – zurück, um die Asche ihrer Mutter zu verstreuen. Hier haben sie jahrelang mit den Eltern die Sommerferien verbracht. Im Kampf um die Liebe der Mutter, die abweisend und grob, dann wieder zärtlich war, haben die Jungen sich damals aufgerieben. Auch der Vater war schwankend zwischen Gleichgültigkeit und Überforderung. Weitgehend waren die Kinder sich selber überlassen. Benjamin, der mittlere Bruder, tastet sich nun in der Erinnerung Stück für Stück zurück, bis zu jenem Sommer, in dem ein schreckliches Unglück geschah und die Familie auseinanderbrach. Wie wird das Treffen der erwachsenen Brüder nun ablaufen? Nur so viel sei verraten: irgendwann taucht vor dem Sommerhaus die Polizei auf…
„Die Überlebenden“ ist ein großartiges Debüt, das von der ersten bis zur letzten Seite fasziniert.

Der zweite Jakob Norbert Gstrein
Jakob Thurner, ein bekannter Schauspieler, wird kurz vor seinem 60. Geburtstag mehrmals von einem aufdringlichen Journalisten interviewt, der eine Biografie über ihn schreiben will. Seine Tochter Luzy, eine fragile junge Frau, ist bei diesen Interviews dabei und fängt nun selber an, Fragen zu stellen. Eine lautet: „Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?“ Er gibt eine (fast) ehrliche Antwort, worauf Luzie unerwartet heftig reagiert und den Kontakt zu ihm abbricht. Jakob muss sich nun seinen Erinnerungen stellen: Was ist zwanzig Jahre zuvor bei Dreharbeiten für einen Film an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wirklich geschehen? Aber auch die familiären Beziehungen beschäftigen ihn zunehmend: Jakob hat drei Ehen hinter sich, und Luzy hat die meiste Zeit bei ihm gelebt; es war eine, wie es schien, innige Vater-Tochter-Beziehung. Nun muss er sich fragen, ob es da nicht auch schwere Versäumnisse gab. „Der zweite Jakob“ ist, aus der Ich-Perspektive erzählt, das eindringliche Portrait eines viel-schichtigen Menschen, der sich nicht festlegen lassen will und simple moralische Urteile verachtet. Nach einem äußerlich erfolgreichen Leben weiß er nicht, wer er ist und wieviel er taugt – und steht dazu. Ein intensives Buch, das zu denken gibt. Der Roman wurde für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert (Shortlist).

Das Leben ist ein vorübergehender Zustand Gabriele von Arnim
Gabriele von Arnim beschreibt in ihrem Buch das Zusammenleben mit ihrem Mann, den sie nach zwei Schlaganfällen zehn Jahre gepflegt hat. Eigentlich wollte sie sich kurz vorher von ihm trennen, doch die Krankheit kam dazwischen. Und für sie bestand kein Zweifel, dass sie sich um ihn kümmern wird. Dies war keine nur aufopfernde Tätigkeit, sondern hatte viele Facetten mit dem zwar bewegungsunfähigen, aber im Geist klaren Mann zusammenzuleben. Sie versucht sich in ihren Mann hineinzuversetzen: „Wie ist es, mit wachem Geist hinter Mauern zu sein?“ Ihr Mann, dem seine Unabhängigkeit immer so wichtig war. Wie hilflos wirken dagegen manche Freunde bei dem Versuch, mit der Situation umzugehen. Wer kann helfen, ohne sich selbst zu betroffen dafür zu fühlen. Welche Wut entsteht bei ihr, wenn es wieder Rückschläge gibt. Von Arnim bezieht Beispiele aus der Literatur mit ein, die ihr in dieser Zeit Unterstützung geben. Es ist kein larmoyantes Buch, sondern mit großer Ehrlichkeit, aber auch Ironie geschrieben, nicht um der Bewunderung willen, sondern um sich nach dem Tod ihres Mannes das Geschehen noch einmal zu vergegenwärtigen. Es ist ein Buch über Liebe, Würde und das Aushalten von Unzumutbarem. Beeindruckend!

An das Wilde glauben Nastassja Martin
Die Anthropologin Nastassja Martin hat über Jahre hinweg die Kultur der Ewenen in Kamtschatka erforscht und dabei immer wieder Monate lang bei einer Familie mitten in der Waldwildnis gelebt. Eines Tages bricht sie trotz der Warnungen der Einheimischen zum gletscherbedeckten Gipfel eines Vulkanberges auf – und hat auf dem Rückweg die Begegnung ihres Lebens! Sie wird von einem Bären angegriffen und überlebt wie durch ein Wunder, schwer verletzt und mit zerbissenem Gesicht. Nach etlichen Operationen zunächst in Russland und später in Frankreich kehrt sie zu ihrer ewenischen Familie zurück, um das Erlebte zu verarbeiten und Heilung zu erfahren. Von manchen wird sie jetzt als „matucha“, Bärin, geehrt, bestimmt „zwischen den Welten“ zu leben. Doch nicht alle Mitglieder der Familie sind von ihrer Rückkehr begeistert...
Nastassja Martin erzählt in ihrem autobiografischen Bericht ungemein packend, wie sie die animistische Vermischung zwischen Mensch und Tier, die sie zuvor als Wissenschaftlerin studiert
hat, nun an sich selber erlebt – als tiefgehende Befreiung.